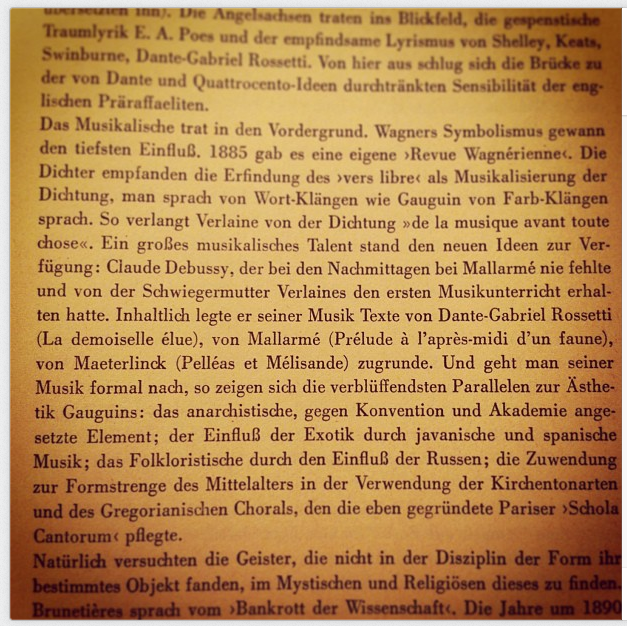„Wenn einer in Bildern denkt, wie Munch, der als Bestandteil dieses nordischen Geistesstroms durch Europa trieb, so verlangt das die Dämonisierung des Erscheinungsbildes der Natur durch die Fühlfähigkeit der menschlichen Psyche und das Ahnungsvermögen des Unbewußten. Munch malt also zum Beispiel keinen Jungmädchenakt, sondern malt „Pubertät“, weil sich das Modell durch die über den optischen Sinn hinaus angesetzten Tastfäden seiner Psyche veränderte und die Bildvorstellung auf diese Veränderung unbewusst reagierte. Er malt zum Beispiel keine Landschaft, sondern „Geschrei“, die Antwort seines Unbewußten auf das Panische der Schöpfung – „ich fühlte den großen Schrei durch die Natur“. Malerei ist ihm gar nicht punktuell auf „Natur“ und „Wirklichkeit“ bezogen. Seine Optik ist die des „zweiten Gesichtes“ und erspäht eine „zweite Wirklichkeit“, in der sich der eigentliche Vorgang des Lebens allein abspielt und den der Künstler mit durchlebt und abspiegelt. (…)
Schon in den Lehrjahren sah er Oberfläche und Symbol als eines. In einem frühen Tagebuch von Munch findet sich unter dem Datum von 1889 eine Eintragung, die die gleiche Sache ausdrückt nur einfacher, mehr vom Maler aus: „Es sollen nicht mehr Interieurs mit lesenden Männer und strickenden Frauen gemalt werden. Es müssen lebende Menschen sein, die atmen, fühlen, leiden und lieben. Ich werde eine Reihe solcher Bilder malen: man soll das Heilige dabei verstehen.“
Das Heilige offenbart sich nicht im Präsens. „Ich sehe“ ist keine Bezeichungsart für eine Tatsache der Offenbarung. (…) Es braucht das Zeitmoment des „visionären“ Anwachsens von außen nach innen und wieder nach außen. Vergangenes und Künftiges durchdringen die Gegenwart und geben ihr Mehrdimensionalität, in der das Heilige aufscheint. Man „sieht“ den brennenden Dornbusch, aber man „sah“ Gott. Ein kleines Zeitmoment ist nötig, dies Anwachsen. Will man das Sichtbare transparent machen in der Hoffnung, ein Transzendentales durchschimmern zu sehen, so changiert die Wortformel aus dem Präsens heraus und heißt: „Ich sehe und erinnerte mich.“ (…)
[Er] suchte (…) neue Symbole, die er in Analogie zu einer fixierten Religiösität „das Heilige“ nannte. Aber der Mensch war allein, einzig in ihm konnte das „Heilige“ als Reflex von außen oder von innen aufleuchten. Kam der Anruf von außen, aus der Landschaft zum Beispiel, so leuchtete das „Heilige“ als das „Panische“ auf, dem zum Beispiel die Alten in der Mythologie der Naturgötter zur Figur verholfen hatten. Kam der Anruf von innen, vom Menschlichen außerhalb seiner reinen Erscheinung als „Natur“, so gewann das „Heilige“ Ausdruck in der Äußerungsgeste der Psychologie. Das Panische und das Pychologische, das sind die beiden Vorstellungsreflexe, mit denen Munch die Bilder fand, die er als Symbole des Daseins verstehen konnte.“
Haftmann, Werner: Malerei im 20. Jahrhundert, 6. durchges. Auflage, München 1979, S. 73–75.