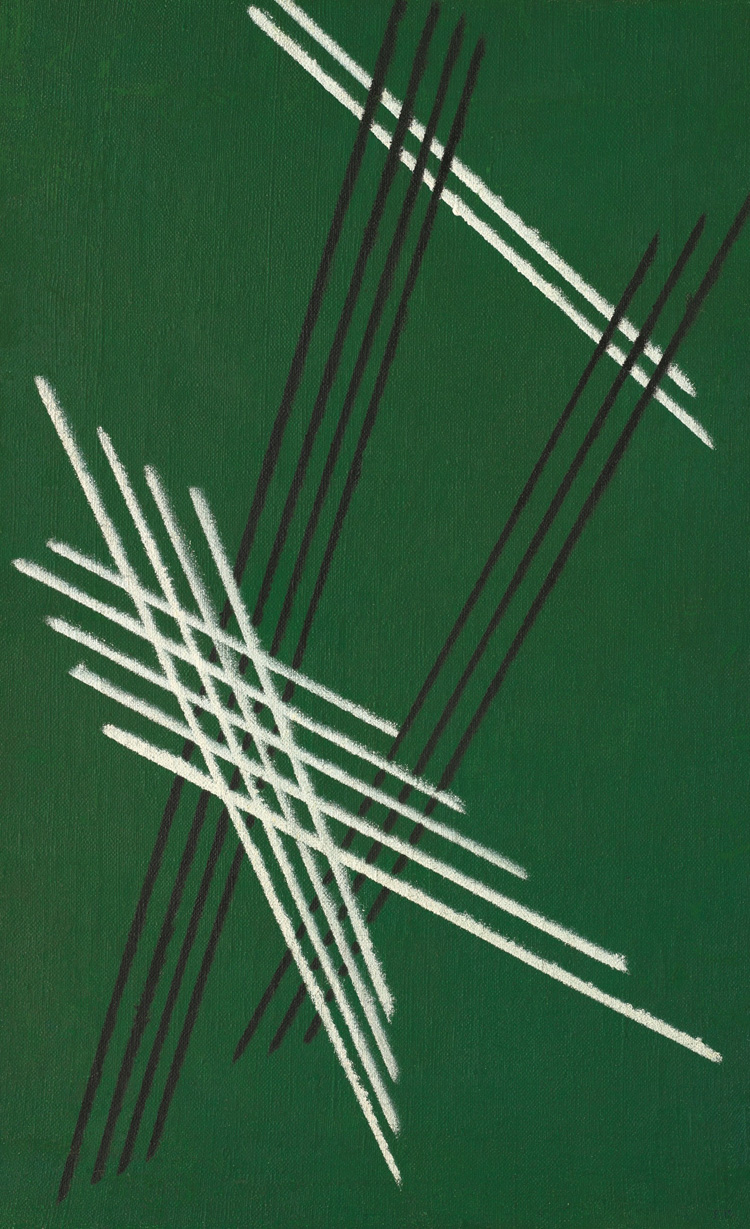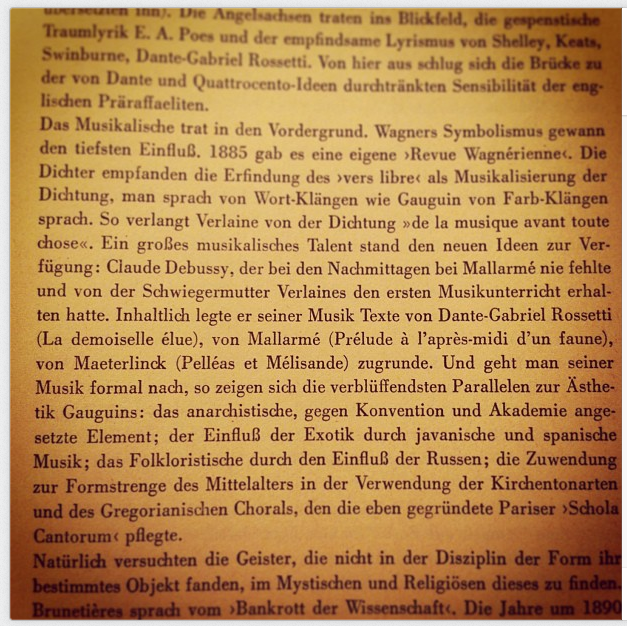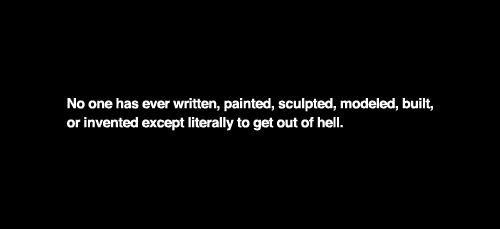Als übermotivierte Studentin und brave Tochter dachte ich mir, fährste doch mal wieder nach Hannover, guckst dir ein Museum an und besuchst danach Mütterchen und Väterchen. Angerufen, Pläne verkündet – und dann etwas zusammengezuckt, als Mütterchen meinte: „Ach, da komme ich doch einfach ins Museum mit! Dann kannst du mir was erklären.“
Ich überlegte noch, ob ich schüchtern einwenden sollte, dass ich nach zwei Semestern gefühlt gar nichts weiß – vor allem nichts über das 20. Jahrhundert –, merkte dann aber selbst: Nee, stimmt nicht. Ich weiß schon ne Menge. Im Vergleich zum großen Ganzen natürlich gar nichts, aber wie ich schon beim letzten Kunsthallenbesuch schrieb: Ich gucke anders. Mal sehen, ob mein Mütterchen davon profitieren könnte.
Das Sprengelmuseum kenne ich noch aus der Zeit, in der ich in Hannover gewohnte habe, aber mein letzter Besuch müsste ungefähr 20 Jahre her sein. Ich erinnerte mich aber gut an die Räume von James Turrell und deswegen ging’s dahin auch zuerst.
Mein Lieblingsraum ist einer, an dem man sich mit einer Hand an einem Handlauf festhalten sollte, mit der anderen kann man an der Wand langstreichen, und dann geht es wenige Meter im Zickzackkurs in einen völlig verdunkelten Raum. Schon im Gang wird das Licht sehr schnell von diffus zu stockfinster, bis man sich im Raum links und rechts vom Gang zu zwei Stühlen getastet hat und Platz nimmt. Und dann sitzt man da und starrt ins Nichts. Oder versucht zu starren, denn man sieht eben – nichts. So eine komplette Finsternis kenne ich sonst nicht; von irgendwoher kommt immer ein Lichtschein, sei er auch noch so schwach, aber hier ist es schlicht schwarz. Man kann die Größes des Raums nicht einschätzen, auch wenn er nicht groß sein dürfte, die Stimmen hallen nicht, wobei die Wände, wie ich hinter mir ertaste, mit Stoff bespannt sind, der Geräusche dämpfen dürfte. Der Witz an diesem Raum ist, dass die Augen sich nach einigen Minuten an die Finsternis gewöhnt haben und dann ein Licht vor dir sichtbar wird. Ich erinnerte mich an ein graues Rechteck, das ich beim letzten Besuch irgendwann ganz schwach und diffus vor mir sah. Dieses Mal sehe ich aber ein Liniengewirr, und ich weiß nicht, ob ich mich schlicht an Quatsch erinnere, sich die Installation geändert hat oder mein Gehirn meinen Augen etwas vorgaukelt. Das graue Rechteck erscheint jedenfalls nicht. Meine Mutter sieht auch Linien, aber erst, nachdem ich davon gesprochen hatte. Ich überlege kurz, mein iPhone zu zücken und die Taschenlampe anzuwerfen, will mir den Raum aber auch nicht ruinieren. Denn ich mag das Gefühl sehr gerne, mal kurz das eigene Sensorium ausgeknipst zu bekommen.
Wir tasten uns wieder aus dem Raum heraus und gehen in den nächsten, wo eine helle Installation vor einer Wand zu schweben scheint. Wenn man länger hinschaut, weiß das Gehirn nicht mehr, was Licht und was Wand ist bzw. es kann sich nicht mehr entscheiden, ob da jetzt wirklich eine Wand ist oder nur Licht. Auch sehr lustig, wobei ich diesen Raum deutlich bunter in Erinnerung hatte. Ich gehe in 20 Jahren noch mal gucken, mal sehen, was dann passiert.
Das Haus hat keinen roten Faden, an dem man sich durch die Jahrzehnte hangelt, man kann irgendwo anfangen. Wir starten mit der Kunst nach 1945. Gleich im ersten Raum hängen einige Dubuffets, die ich inzwischen erkenne, wie ich mich innerlich piepsend freue. Mein Liebling ist die La voiture princière von 1961, an der ich den Bruch zwischen Bildtitel und Bildinhalt mag. Der „fürstliche Wagen“ ist ein Renault, die Figur, die darin sitzt, scheint mir ein gut gelaunter Mensch zu sein, der unadlig zur Arbeit fährt und zum Radio mitsingt anstatt Staatsgeschäften nachzugehen. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Und wenn dieses Bild etwas ganz anderes aussagen soll, ist mir das gerade egal, denn zum ersten Mal überlege ich nicht, ob meine Deutung wohl richtig ist, sondern ich nehme sie so hin. Wenn ich irgendwas in den letzten zwei Semestern Kunst und Musik gelernt habe, dann: Wenn du deine Meinung belegen kannst, dann stimmt die. Und so stehe ich nicht zögerlich und fragend vor einem Bild wie früher, sondern erzähle mir selbst (und Mama), was ich sehe. Und dann passt das. Toll.
Mein zweiter Liebling in diesem Raum ist Jean-Paul Riopelles Bei Nacht (Nuitamment) von 1956. Von dem Mann hatte ich noch nie gehört, will jetzt aber dringend mehr von ihm sehen. Wie bei Bildern von van Gogh kommt einem hier die Farbe entgegen, in so dichten Lagen ist sie auf die Leinwand verteilt, man kann das Werkzeug erkennen, das zum Verteilen benutzt wurde, zum Schichten und Kanten. Aber wo bei van Gogh jeder Pinselstrich Schmerz verrät, spürt man hier Dynamik und Kraft, Vorankommen, Bewegung. Mich hinterlässt das Bild trotz seiner Spannung absolut ruhig, so als ob die laute Großstadt mit ihren Neonlichtern, Spiegelungen und Farbkonstrasten kurz angehalten wurde, um sich mir in ihrer schillernden Schönheit zu präsentieren. Sobald ich mich wegdrehe, wird sich das Bild bestimmt ändern.
Der nächste Raum gehört Horst Antes. Hier hängen mehrere Figuren von ihm, die mir in ihrer schlichten Farbigkeit und Körperlichkeit sehr gefallen. Die Google-Bildersuche spuckt, wenn ich richtig geguckt habe, kein einziges der Bilder aus, die hier hängen – sie haben weniger Konturen, sind flächiger, weniger konkret als das, was man sofort mit Antes’ Namen verbindet. Die FAZ schreibt sehr schön über den Herrn, und seit dem Artikel weiß ich auch, was ich mir nächste Woche beim Spontanbesuch in Berlin angucke.
Ich entdecke die seltsamen Kompositionen von Alfred Manessier und Julius Bissier für mich, vertiefe mich in Rubernos von Emil Schumacher und kann dann mal wieder vor Mama ein bisschen Wissen heucheln, indem ich ihr das Blau von Yves Klein zeige. An seinem Werk Victoire de Samothrace von 1962 kann ich auch gleichzeitig mein bisheriges Wissen über Denkmäler abrufen und ihr erklären, was die Siegesdame alles nicht ist.
Im gleichen Raum wie Klein stehen auch einige Werke von Niki de Saint Phalle, die man als Hannoveranerin natürlich durch die Nanas kennt. So gerne ich diese Skulpturen mag – sonst kann ich mit ihrem Werk eher weniger anfangen. Auch wenn ich ihr Selbstporträt mit den Haaren aus Kaffeebohnen durchaus charmant fand. Neben de Saint Phalle ist hier aber auch einiges von Dieter Roth zu bewundern, den ich persönlich lieber mag. An seiner Ersten Kubistischen Geige von 1984/1988 kann ich Mama ein bisschen was über den Kubismus erzählen, kriege den Bogen (Bogen, haha) zum Roth’schen Werk aber nur durch die Farbigkeit hin. Im Geigenkasten liegt ein Foto eines kubistischen Bilds (ich habe mir nicht gemerkt, welches), das genau in den Farben gestaltet ist, mit denen Roth seine Geige verziert.
Nach ein bisschen Pop-Art von Warhol (Flash), Lichtenstein (Two Paintings/Alien) und Lindner (New York City III) kommen dann die ersten Installationen, unter anderem von Nauman und Franz Erhard Walther, dessen Mit sieben Stellen und Mantel mich sehr beeindruckt hat. Es besteht aus einem beigefarbenen Stoffhintergrund, auf dem sich weitere Stoffbahnen befinden. Ein Mantel aus dem gleichen Stoff deutet eine durchschnittliche menschliche Größe an. Orangefarbene, grüne, braune und rote Stoffteile umschließen Raumteile oder zeigen Verläufe von Raum auf, zwischen ihnen kann man imaginäre Linien ziehen und sich das Werk so erschließen. 18 Zeichnungen verdeutlichen die Gedankengänge, die hinter dem massiven Werk stecken, aber sie sind keine Gebrauchsanweisung. Es ist ein Spiel mit Größe und Körperlichkeit, mit Maßstäben und Erwartungen. (Oder was ganz anderes, aber das war’s für mich.) Wie ich schon bei Beuys im Lenbachhaus in München überrascht gemerkt habe: Die moderne Kunst hat sich an mich rangewanzt, und ich kann soviele Raffael-Bücher kaufen wie ich will, ich kann mich nicht mehr wehren.
Aber ein bisschen in die Vergangenheit darf ich schon noch schweifen, denn im Sprengelmuseum hängen auch die Neue Sachlichkeit, ein bisschen Kubismus und Futurismus und direkt dahinter (oder davor, je nachdem von wo man kommt) meine Lieblinge von der Brücke.
In der Neuen Sachlichkeit sind mir erstmals Grethe Jürgens und Ernst Thoms aufgefallen. Zwei Räume weiter konnte ich dann wirklich mal was erklären anstatt nur rumzumeinen, denn dort hängen ein paar Picassos gegenüber von Boccionis A strada entra nella casa von 1911. Das ist dort wirklich bilderbuchmäßig und man kann prima die Unterschiede dieser beiden Stilrichtungen erörtern und warum Bilder, die zur gleichen Zeit entstanden sind, so unterschiedlich aussehen.
Noch ein Raum für Picasso, durch den ich zugegebenermaßen etwas durchgesprintet bin, denn ich konnte langsam nichts mehr sehen. Den armen Emil Nolde habe ich auch nur gestreift, aber dafür konnte ich dann etwas länger bei meinem Liebling Kirchner rumstehen, der sich seinen Raum natürlich mit den Brücke-Kumpels Müller und Schmidt-Rottluff teilt, genau wie in der Hamburger Kunsthalle. Lustigerweise gefielen mir hier die Schmidt-Rottluffs besser als in Hamburg, während Herr Kirchner mich etwas underwhelmte. Aber im nächsten Raum konnte ich mich zum Ausgleich über diverse von Jawlenskys freuen. Mama freute sich über Macke und Marc (mal wieder Pferde. Ich kann diese Pferde nicht mehr sehen), während ich endlich die Klappe halten konnte.
Ich habe mich darüber gefreut, dass ich doch schon mehr wusste als ich dachte, aber ich habe auch gemerkt, dass ich lieber alleine in Museen rumlaufe. Kein schlechtes Gewissen, weil man statt drei Minuten fünfzehn vor einem Werk stehenbleiben will (die Zeit hätte ich mir gerne bei Riopelle und Walther gegönnt), und auch keins, weil man an manchen Bildern einfach vorbeirennt. Wenn ich alleine gewesen wäre, wäre ich kurz zum Kaffeetrinken rausgegangen, hätte meine Füße in den Maschsee gehalten und dann doch eine zweite Runde gedreht bzw. mir den Rest angeguckt, den wir dieses Mal nicht geschafft haben. So ist mir erst beim Rausgehen aufgefallen, dass ich den Merzbau gar nicht gesehen habe, in den ich als Kind sogar noch reinklettern durfte. Ich habe dieses Mal auch gemerkt, dass ich die Sache ernster nehme als sonst. Wo ich sonst einfach nur gucke, um meine innere Bildersammlung laaaangsam zu ergänzen, habe ich dieses Mal an vielen Bildern versucht, als angehende Kunsthistorikerin draufzugucken – also so, als ob ich ein Referat halten oder eine Hausarbeit schreiben muss. Ich erzähle mir in allen Einzelheiten, was ich sehe, welche Farben, in welcher Anordnung, in welchem Auftrag, wo sehe ich Konturen, wo erschließen sich mir Zusammenhänge, welche inneren Dynamiken spüre ich bzw. wo kann ich sie am Bild nachvollziehen, so dass aus ihnen mehr wird als nur ein diffuses Gefühl. Ich versuche, ein Bild zu erkennen und es nicht einfach so hinzunehmen. Und das kostet halt Zeit, und es ist ein bisschen anstrengend. Aber – natürlich – auch ganz großartig.
—
PS: Dieser Eintrag ist so bilderarm, weil man ü-ber-haupt nicht fotografieren durfte. Direkt hinter der Kasse hängt schon ein Riesenschild, das von Copyright redet und dass man in die Hölle kommt, wenn. Also habe ich, wie immer, nur die Schilder fotografiert, auf denen die KünstlerInnennamen und die Werkdaten stehen, weil ich zu faul bin, mir das aufzuschreiben. Aber: Selbst das darf man nicht. Als ich darüber quengelig twitterte, kam von @ishtar noch die Krönung: „Geht noch besser. Im Haus von Georgia O’Keeffe ist auch Zeichnen und handschriftliche Notizen machen untersagt.“ Pffft.